Hintergrund
"Eichmann in uns" - Experimente zum autoritären Charakter
William Foster steckt im Stau. Immer aggressiver wird er, weil nichts voran geht. Seine Leidensgenossen empfindet er als Schuldige. 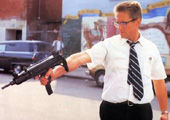 Er beschimpft sie und pöbelt sie an. Dann lässt er sein Auto mitten in der Blechkarawane stehen und stapft in die City von Los Angeles. Er hadert mit Gott und der Welt, bewaffnet sich, bedroht Menschen, beginnt zu töten. Am Ende wird er selbst erschossen. Das ist die Geschichte, die Joel Schumachers Film Falling Down (USA 1993) erzählt, eine Geschichte vom Einsturz der dünnen Wand, die den Menschen als Zivilisationswesen von seiner destruktiven Natur trennt.
Er beschimpft sie und pöbelt sie an. Dann lässt er sein Auto mitten in der Blechkarawane stehen und stapft in die City von Los Angeles. Er hadert mit Gott und der Welt, bewaffnet sich, bedroht Menschen, beginnt zu töten. Am Ende wird er selbst erschossen. Das ist die Geschichte, die Joel Schumachers Film Falling Down (USA 1993) erzählt, eine Geschichte vom Einsturz der dünnen Wand, die den Menschen als Zivilisationswesen von seiner destruktiven Natur trennt.
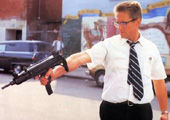
Falling Down
Fragen zur Natur des Menschen
Aber was ist diese Natur? Ist der Mensch von Natur aus frei? Ist er vernünftig? Ist er ein Barbar? Ist er autonom oder manipulierbar? Spätestens seit der Aufklärung werden diese Fragen diskutiert, denn sie sind relevant für die Organisation des sozialen Zusammenlebens. Im 16. Jahrhundert beginnen Philosophen und Schriftsteller verstärkt Gedankenexperimente über Gesellschaftsmodelle anzustellen. Utopia heißt die Insel, auf der Thomas Morus 1516 in seinem gleichnamigen Roman den ersten großen Ideenversuch über die ambivalente Natur des Menschen und ihre soziale Zähmung in einer fiktiven Staatsform startet. Seither nennt man die literarische Gattung solcher Gedankenkonstrukte Utopie.
Der französische Romancier und Dramatiker Pierre Carlet de Marivaux lässt 1733 in dem Theaterstück Der Streit (La Dispute) ein Experiment zur Natur des Menschen zelebrieren. Ein Herrscher lässt vier Findelkinder, zwei Mädchen und zwei Jungen, isoliert voneinander aufwachsen und konfrontiert sie dann miteinander, um ihre erotischen Urtriebe zu erforschen. Er will herausfinden, welches Geschlecht die Untreue in die Welt bringt. Zwar verweigert der Text eine eindeutige Antwort, doch schon das Thema ist interessant, weil es nach Wurzeln für Verhalten sucht.
Der französische Romancier und Dramatiker Pierre Carlet de Marivaux lässt 1733 in dem Theaterstück Der Streit (La Dispute) ein Experiment zur Natur des Menschen zelebrieren. Ein Herrscher lässt vier Findelkinder, zwei Mädchen und zwei Jungen, isoliert voneinander aufwachsen und konfrontiert sie dann miteinander, um ihre erotischen Urtriebe zu erforschen. Er will herausfinden, welches Geschlecht die Untreue in die Welt bringt. Zwar verweigert der Text eine eindeutige Antwort, doch schon das Thema ist interessant, weil es nach Wurzeln für Verhalten sucht.
Die menschliche Gewaltbereitschaft
Neben dem Eros ist die Gewaltbereitschaft des Menschen der Stoff, aus dem soziale Probleme entstehen. In jeder Gesellschaft ist die Eindämmung des Gewaltpotenzials eine zentrale Herausforderung und wird daher in juristischen Regelwerken von der Gesetzesstele des babylonischen Herrschers Hammurabi über die Zehn Gebote bis zum Strafgesetzbuch herausragend bearbeitet. Doch damit wird nur das Phänomen reguliert. Was den Menschen zum Vergewaltigen oder Morden bewegt, kann juristisch ebenso wenig begründet werden wie biologisch endgültig ergründet. Im 20. Jahrhundert wurden allerdings zahlreiche Versuchsanordnungen aufgebaut, um die menschliche Aggressionsbereitschaft besser begreifen zu lernen. Es waren künstlerische und sozialpsychologische Versuchsanordnungen.
Herr der Fliegen
Zu den bedeutendsten literarischen Gedankenexperimenten gehört der Roman Herr der Fliegen (Lord of the Flies) des britischen Literaturnobelpreisträgers William Golding aus dem Jahr 1954.  Eine Gruppe englischer Schüler wird durch einen Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel verschlagen. Zwei Strategien des Überlebens bieten sich an, einmal die rationale Nutzung der zivilisatorischen Relikte, die gerettet werden konnten (dafür steht die Figur des Ralph), zum anderen ein Rückfall in archaische Verhaltensweisen mit Jagdopfern, Feind-Ausgrenzungen und Ritualen (dafür steht die Figur des Jack). Wie in Falling Down bricht auch hier die dünne Wand zwischen Zivilisation und Barbarei schnell ein. In seiner Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1963 hat Peter Brook diesen Prozess präzise analysiert. Eine weitere Verfilmung durch Harry Hook aus dem Jahr 1988 hat hingegen die Gruppenkonflikte nur plakativ dramatisiert.
Eine Gruppe englischer Schüler wird durch einen Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel verschlagen. Zwei Strategien des Überlebens bieten sich an, einmal die rationale Nutzung der zivilisatorischen Relikte, die gerettet werden konnten (dafür steht die Figur des Ralph), zum anderen ein Rückfall in archaische Verhaltensweisen mit Jagdopfern, Feind-Ausgrenzungen und Ritualen (dafür steht die Figur des Jack). Wie in Falling Down bricht auch hier die dünne Wand zwischen Zivilisation und Barbarei schnell ein. In seiner Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1963 hat Peter Brook diesen Prozess präzise analysiert. Eine weitere Verfilmung durch Harry Hook aus dem Jahr 1988 hat hingegen die Gruppenkonflikte nur plakativ dramatisiert.

Herr der Fliegen
Verhalten in der Gruppe
Die verheerenden Gewaltexzesse des 20. Jahrhunderts durch Nationalsozialismus, Stalinismus und Maoismus nutzten offensichtlich gruppendynamische Vorgänge, die das Individuum von zivilisatorischer Selbstverantwortung entlasten und seine atavistischen Anlagen freisetzen. Die Prozesse lassen sich auf Rudelverhalten zurückführen: Unterwürfigkeit gegenüber Alpha-Tieren, strenge Einhaltung hierarchischer Positionen, Gruppenaggression gegenüber Feinden, die außerhalb der Gruppe angesiedelt sind. Sozialpsychologisch kommt dabei der Begriff vom "autoritären Charakter" ins Spiel, wie ihn Erich Fromm und Theodor W. Adorno entwickelt haben. Auf aktiver Seite zeichnet sich der autoritäre Charakter durch Freude an der Beherrschung von Schwächeren und Befriedigung durch Machtausübung aus. Die Bereitschaft zur Unterwerfung unter hierarchisch höher Gestellte und die Verantwortungsentlastung durch blinden Gehorsam kennzeichnen die passive Variante.
Die Experimente
Diese sozialpsychologische Disposition macht Menschen offensichtlich bereit, in Gewaltsystemen zu funktionieren. Diese Theorie versuchten zahlreiche Experimente nach dem Ende des Nationalsozialismus, der das autoritäre Modell geradezu idealtypisch verkörperte, zu belegen. In den Jahren 1949, 1953 und 1954 führte Muzafer Sherif drei sogenannte Ferienexperimente durch. In Ferienlagern wurden Kinder und ihre besten Freunde in unterschiedlichen Gruppen untergebracht und in Wettkampfsituationen versetzt. Es stellte sich heraus, dass sich Freundschaften schnell in Feindschaften verwandelten und der Identifikation mit der neuen Gemeinschaft geopfert wurden.
Besonders bekannt wurde Stanley Milgrams Abrahamexperiment aus dem Jahr 1962. Die Probanden wurden aufgeteilt in Schüler und Lehrer.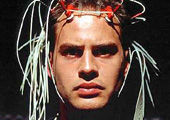 Die Lehrer forderte man dazu auf, die Schüler im Falle falscher Antworten mit sich steigernden Stromstößen zu bestrafen. Wie der biblische Abraham im unterwürfigen Gehorsam zu Gott bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern, so waren nahezu alle Lehrer bereit, auf Anweisung von Laborpersonal unter einem pädagogischen Vorwand die Schüler mit Elektrizität zu foltern. Der Bayerische Rundfunk hat 1970 dieses Experiment mit gleichen Resultaten in Deutschland nachgestellt und in dem Dokumentarfilm Abraham - ein Versuch (Hans Lechleitner, David Marc Mantell, Paul Matussek) festgealten. 1971 schließlich veranstaltete Philip Zambardo an der kalifornischen Standford Universität ein Experiment, das Studenten in die Rollen von Gefängnisinsassen und Gefängniswärtern versetzte. Auch hier identifizierten sich die Wärterdarsteller so sehr und so brutal mit ihren Rollen und legten zivile und humane Verhaltensweisen ab, dass der auf 14 Tage angelegte Versuch nach sechs Tagen beendet werden musste. In dem deutschen Spielfilm Das Experiment hat Oliver Hirschbiegel 2000 die Ereignisse nachempfunden.
Die Lehrer forderte man dazu auf, die Schüler im Falle falscher Antworten mit sich steigernden Stromstößen zu bestrafen. Wie der biblische Abraham im unterwürfigen Gehorsam zu Gott bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern, so waren nahezu alle Lehrer bereit, auf Anweisung von Laborpersonal unter einem pädagogischen Vorwand die Schüler mit Elektrizität zu foltern. Der Bayerische Rundfunk hat 1970 dieses Experiment mit gleichen Resultaten in Deutschland nachgestellt und in dem Dokumentarfilm Abraham - ein Versuch (Hans Lechleitner, David Marc Mantell, Paul Matussek) festgealten. 1971 schließlich veranstaltete Philip Zambardo an der kalifornischen Standford Universität ein Experiment, das Studenten in die Rollen von Gefängnisinsassen und Gefängniswärtern versetzte. Auch hier identifizierten sich die Wärterdarsteller so sehr und so brutal mit ihren Rollen und legten zivile und humane Verhaltensweisen ab, dass der auf 14 Tage angelegte Versuch nach sechs Tagen beendet werden musste. In dem deutschen Spielfilm Das Experiment hat Oliver Hirschbiegel 2000 die Ereignisse nachempfunden.
Besonders bekannt wurde Stanley Milgrams Abrahamexperiment aus dem Jahr 1962. Die Probanden wurden aufgeteilt in Schüler und Lehrer.
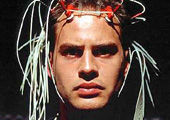
Das Experiment
Blue Eyed
Noch eine Versuchsanordnung gibt es, die filmisch detailliert dokumentiert wurde und den Zuschauenden die Bereitschaft nahezu jedes Menschen für einen aktiv demütigenden Habitus vor Augen führt. Es ist Jane Elliotts ursprünglich antirassistisch gedachtes Workshop-Projekt Blue Eyed. Elliott, eine ehemalige Lehrerin aus dem Mittelwesten der USA, veranstaltet Seminare, in denen alle blauäugigen Gruppenteilnehmende in ähnlicher Weise diskriminiert werden wie es Schwarze erleben mussten und müssen. Auch in diesem Experiment, das Bertram Verhaag für den Film Blue Eyed (Deutschland 1996) mit Kameras beobachtet hat, bringen die als überlegen gesetzten Braunäugigen ihr rassistisches Potenzial rückhaltlos zum Ausdruck.
Die Welle
Anlässlich seines Versuchs in Stanford hat Philip Zimbardo erklärt, er wollte den "Eichmann in uns" hervortreten lassen (Adolf Eichmann war im Nationalsozialismus als zuständiger Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt der bürokratische Organisator der massenhaften Ermordungen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern).  Ähnliches plant der Lehrer Ben Ross mit der Gruppenbewegung Die Welle in Morton Rhues gleichnamigen Roman (The Wave, 1981). Mit der autoritär-faschistoiden Bewegung will er seine Schülerinnen und Schüler davon überzeugen, dass eine Diktatur auch mit ihnen möglich ist. Er muss erkennen, dass autoritäre Strukturen einen großen Reiz ausstrahlen und die Schleusen der Gewalt entriegeln. Die Ereignisse, die Morton Rhue schildert, beruhen auf einer authentischen Begebenheit an einer kalifornischen High-School im Jahr 1967. Der verbreitete Roman, die aktuelle deutsche Verfilmung von Dennis Gansel (Die Welle, Deutschland 2008) und eine ebenfalls ganz neue Comic-Version (2007), gezeichnet von Stefani Kampmann, führen den Rezipienten/innen die eigene Bereitschaft zum Mitmachen schonungslos vor Augen. Wir sind gewarnt. Wie wir handeln würden, falls die Versuchung tatsächlich an uns herantreten sollte, bleibt allerdings offen.
Ähnliches plant der Lehrer Ben Ross mit der Gruppenbewegung Die Welle in Morton Rhues gleichnamigen Roman (The Wave, 1981). Mit der autoritär-faschistoiden Bewegung will er seine Schülerinnen und Schüler davon überzeugen, dass eine Diktatur auch mit ihnen möglich ist. Er muss erkennen, dass autoritäre Strukturen einen großen Reiz ausstrahlen und die Schleusen der Gewalt entriegeln. Die Ereignisse, die Morton Rhue schildert, beruhen auf einer authentischen Begebenheit an einer kalifornischen High-School im Jahr 1967. Der verbreitete Roman, die aktuelle deutsche Verfilmung von Dennis Gansel (Die Welle, Deutschland 2008) und eine ebenfalls ganz neue Comic-Version (2007), gezeichnet von Stefani Kampmann, führen den Rezipienten/innen die eigene Bereitschaft zum Mitmachen schonungslos vor Augen. Wir sind gewarnt. Wie wir handeln würden, falls die Versuchung tatsächlich an uns herantreten sollte, bleibt allerdings offen.

Die Welle
Autor/in: Herbert Heinzelmann, Publizist, Medienpädagoge und Dozent an der Universität Erlangen, 27.02.2008
Mehr zum Thema auf kinofenster.de:
Das Experiment (Filmbesprechung vom 08.03.2001)
Das Standord-Prison-Experiment (Hintergrund vom 08.03.2001)
Blue Eyed (Unterrichtsmaterialien)
Das Standord-Prison-Experiment (Hintergrund vom 08.03.2001)
Blue Eyed (Unterrichtsmaterialien)
Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.
Über kinofenster.de



