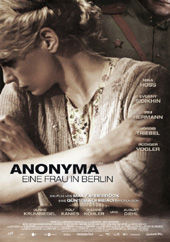Anonyma – Eine Frau in Berlin
Die letzten Kriegstage
April 1945, die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Berlin liegt in Trümmern. Ängstlich verschanzen sich Frauen und Kinder in den Kellern ihrer zerstörten Häuser und harren einer ungewissen Zukunft. Sie sind Nachbarinnen und Freundinnen, Witwen und Ehefrauen, deren Männer noch an der Ostfront kämpfen. Der Einmarsch der Roten Armee wird für viele von ihnen zu einer traumatischen Erfahrung, denn sie werden von den Soldaten mehrfach vergewaltigt. So auch die knapp dreißigjährige Anonyma, eine selbstbewusste, intelligente Journalistin und Fotografin, die sich als Einzige auf Russisch verständigen kann. Ihre Erlebnisse zwischen dem 20. April und dem 22. Juni 1945 dokumentiert sie in einem Tagebuch, das ihr Mann nach seiner Rückkehr lesen soll. Weil sie nicht in ständiger Angst vor den körperlichen Übergriffen leben will wie die anderen Frauen, von denen etliche verzweifelt Selbstmord begehen, fasst Anonyma einen Entschluss: Sie wird sich einen Beschützer suchen, einen ranghohen sowjetischen Offizier, dem sie "freiwillig zu Diensten" ist, damit er ihr seine Untergebenen vom Leibe hält. Doch es entwickelt sich, womit sie nicht gerechnet hätte: Der zurückhaltende, gebildete Andrej berührt ihr Herz, es entwickelt sich eine von echter Zuneigung geprägte Beziehung.
Strategie des Überlebens
Max Färberböcks Film basiert auf dem 2003 neu aufgelegten Tagebuch einer Zeitzeugin, die bis zu ihrem Tod anonym geblieben ist. Schon Ende der 1950er-Jahre wurde Eine Frau in Berlin - Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945 unter dem Pseudonym "Anonyma" und unter Anleitung von Kurt W. Marek, der als Sachbuchautor unter dem Pseudonym C. W. Ceram

Tabus brechen
Mit seiner filmischen Adaption leistet Färberböck selbst 53 Jahre nach den historischen Ereignissen Pionierarbeit. Denn lange galten die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen durch Soldaten der Roten Armee als Tabuthema. Die Betroffenen schwiegen oftmals aus Scham, eine offene Anprangerung wurde dadurch erschwert, dass die Täter überwiegend Soldaten der Sowjetunion waren, die Opfer Bürgerinnen der späteren DDR. Es war gerade in der DDR nicht opportun, den Befreiern solche Vorwürfe anzulasten. Angesichts der eigenen schweren Schuld wurde es zudem in Nachkriegsdeutschland als unangemessen betrachtet,

Ambivalentes Bild
Färberböck erzählt aus der Perspektive seiner Heldin, deren Tagebucheinträge das Geschehen aus dem Off kommentieren, nähert sich dem Sujet jedoch mit großem Einfühlungsvermögen für beide Seiten, deutsche Frauen und sowjetische Soldaten.

Ästhetik der Ausweglosigkeit
Seine starke, beklemmende Wirkung verdankt der Film einem erstklassigen Ensemble und einer sensiblen ästhetischen Umsetzung. Anonyma – Eine Frau in Berlin ist ein rasant montiertes Kammerspiel (der größte Teil des Films spielt in Anonymas zerbombtem Wohnhaus), das die Instabilität und tendenzielle Bedrohlichkeit der Situation authentisch nachempfindet. Zugleich bewahrt sich der Film eine Subtilität bei der Kameraführung, in den Dialogen und dem Habitus der Darsteller/innen. Die zarte Liebesgeschichte zwischen Anonyma und dem Major wird nur angedeutet, drückt sich in Blicken und heimlichen Gesten aus. In den Vergewaltigungsszenen vermeidet die Regie jeglichen Voyeurismus, die Gewalt findet sich überwiegend in der Mimik der Betroffenen wider. Angst, Ekel, Schmerz und Verzweiflung stehen den Frauen ins Gesicht geschrieben, ihren panischen Fluchtversuchen folgt die entfesselte Handkamera hastig durch lange Kellergänge. Auch vermitteln die wenigen Schauplätze – finstere Kellergänge, provisorisch hergerichtete Wohnungen, triste Straßentrümmerlandschaften

Autor/in: Kirsten Liese, Publizistin mit den Schwerpunkten Film, Frauen und Musik, 25.09.2008
Mehr zum Thema auf kinofenster.de:
Sisters in Law (Filmbesprechung vom 12.09.2007)
Kino-Film-Geschichte XXV: Opfer und Täter/innen – Kinder im Krieg (Hintergrund vom 01.05.2005)
Esmas Geheimnis - Grbavica (Filmbesprechung vom 29.09.2006)
Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Kino-Film-Geschichte XXV: Opfer und Täter/innen – Kinder im Krieg (Hintergrund vom 01.05.2005)
Esmas Geheimnis - Grbavica (Filmbesprechung vom 29.09.2006)
Über kinofenster.de