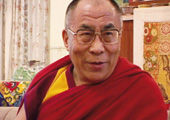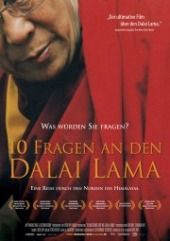Begegnung in Indien
Dharamsala, der Sitz der tibetischen Exilregierung des 14. Dalai Lama, ist ein kleiner Ort in Nordindien und das Hauptziel des US-amerikanischen Reisejournalisten Rick Ray. Als dieser im Jahr 2005 zu einer Indienreise aufbricht, sind die jüngsten Unruhen und Gewalteskalationen in Tibet, die Diskussionen über einen möglichen Boykott der 29. Olympischen Sommerspiele in Beijing ausgelöst haben, noch nicht absehbar. Folglich bietet Rays Film zwar keinen aktuellen Beitrag zum sino-tibetischen Konflikt, dafür beleuchtet er deutlich die Hintergründe. Noch bei Antritt der Reise war ungewiss, ob es zu einer persönlichen Begegnung Rays mit dem inzwischen 72-jährigen politischen und religiösen Führer der Tibeter kommen würde. Auf sein Interviewgesuch per E-Mail erhielt der Filmemacher aber rasch positiven Bescheid. Eine 45-minütige Privataudienz wurde ihm gewährt, während der er zehn Fragen stellen durfte. Diese Begegnung bildet den dramaturgischen Höhepunkt von Rays Dokumentarfilm, der durch die gegenwärtigen Aufstände in Lhasa und den Nachbarprovinzen, bei denen die Tibeter zornig ihre politische Unabhängigkeit und die Rückkehr des Dalai Lama fordern, eine unerwartete Aktualität gewinnt.
Ehrfurcht und Bewunderung
Rick Ray erhofft sich bei seiner Audienz Antworten auf universelle Fragestellungen – dass ein kurzes Gespräch diese nicht liefern kann,

wird im Verlauf des Films jedoch deutlich. Manche Fragen bewegen sich allerdings hart an der Grenze zum Klischee ("Warum wirken arme Menschen glücklicher und fröhlicher als Reiche?"), manche Antworten scheinen allzu vereinfachend, wie der Lösungsvorschlag des Dalai Lama zum Konflikt im Nahen Osten – "Gemeinsame Feste feiern, Picknicks veranstalten und negative Emotionen vergessen". Neben weltpolitischen Themen wie Armut, Überbevölkerung oder Umweltzerstörung kommen die ungewisse Zukunft Tibets und Chinas Besatzungspolitik zur Sprache, die der Dalai Lama – damals wie heute – als "kulturellen Völkermord" brandmarkt. Durch die breite Ansiedlung von Chinesen in ihrer Heimat fortschreitend marginalisiert, sind viele Tibeter heute zudem mit Repressionen, Armut und Arbeitslosigkeit konfrontiert – eine Tatsache, die der Exilherrscher deutlich in Erinnerung ruft.

Trotz der insgesamt durchaus informativen Ausführungen krankt das Gespräch jedoch an der ehrfürchtigen Bewunderung, die der Filmemacher dem Friedensnobelpreisträger entgegenbringt. Entsprechend werden die Ansichten seines Interviewpartners weder diskutiert noch hinterfragt, womit der Film die große Chance einer differenzierten Auseinandersetzung verschenkt. So fragt Ray etwa, wie es dem Dalai Lama gelänge, angesichts der fortdauernden Diskriminierung der Tibeter durch die chinesischen Besatzer sich weiterhin für einen konstruktiven, gewaltfreien Dialog einzusetzen – zumal dieser wisse, dass seine Politik der Gewaltlosigkeit und des Verzichts tibetischer Eigenstaatlichkeit nicht von allen Tibetern akzeptiert werde? Durch "Selbstdisziplin" und besseres Wissen erklärt der Dalai Lama, denn "die Macht der Gewehre ist nur von kurzer Dauer". Allerdings räumt er ein, dass man sich unter bestimmten Bedingungen auf einen Angriff hin verteidigen dürfe. Leider forscht Ray nicht weiter nach, wann genau eine solche Ausnahmehandlung gerechtfertigt sei oder welche alternativen Möglichkeiten er zur Lösung des jahrzehntelangen Konflikts mit China sieht, in dem sich bislang keine friedliche Lösung abzeichnet.
Fülle an historischen Materialien
Anders als der Titel vermuten lassen könnte, bietet
10 Fragen an den Dalai Lama jedoch weitaus mehr als einen bebilderten Dialog. Das persönliche Treffen mit dem 14. Dalai Lama bestimmt nur das letzte Filmdrittel, dem Ray
Panoramaeinstellungen imposanter Landschaftsaufnahmen von Indien und Tibet, beschauliche Szenen klösterlicher Rituale, sowie Exkurse zum Buddhismus und zur Biografie des Dalai Lama vorausschickt. Die Stärken des Films liegen vor allem in der profunden Dokumentation der tibetischen Geschichte ab 1950 mit gut recherchierten, teilweise seltenen historischen Archivaufnahmen:

Bilder der Ernennung des 15-jährigen Dalai Lama zum Staats- und Regierungsoberhaupt nach der Okkupation Tibets durch die Volksrepublik China im Jahr 1950, Filmaufnahmen des blutigen Aufstands des tibetischen Volkes gegen die Invasoren neun Jahre später und der Flucht des jungen Herrschers aus der Hauptstadt Lhasa. Zehntausende Menschen kamen nach Angaben der tibetischen Exilregierung bei dem Aufstand ums Leben, während der chinesischen Kulturrevolution (1966-1969) wurden etwa 6000 Klöster und unzählige tibetische Kunstschätze vernichtet, Anhänger des Dalai Lama, Nonnen und Mönche gefoltert, inhaftiert und ermordet. Seither bemüht sich der Dalai Lama in seiner Exilregierung in Dharamsala um eine internationale Unterstützung für ein autonomes Tibet.
Weitsichtige Persönlichkeit
Aus dem Off schildert Ray seine durchweg positiven Reiseerfahrungen mit der indischen und tibetischen Bevölkerung, die
Filmmusik, überwiegend raunende tibetische Klänge, beschwört suggestiv die Mystik einer fremden Kultur.
In beschaulichem Rhythmus
montierte Archivmaterialien, Interviewausschnitte und pittoreske Landschaftspanoramen bereiten die inhaltlich komplexen Sachverhalte ästhetisch anspruchsvoll für die Zuschauenden auf. Dass
10 Fragen an den Dalai Lama vordergründig einem buddhistischen Werbefilm näher kommt als einer objektiven Dokumentation, tut dem informativen Gehalt jedoch kaum Abbruch. Anschaulich verdeutlicht der Film die komplexen Hintergründe des sino-tibetischen Konflikts und zeigt fast visionär eine ganze Kette von Ereignissen auf, die letztlich zu den aktuellen politischen Unruhen geführt haben. Auch als persönliche Hommage liefert der Film fruchtbare Diskussionsansätze für die schulpädagogische Arbeit, porträtiert er doch einen ebenso weitsichtigen wie bescheidenen Menschen, der seine Prinzipien von Toleranz, Pazifismus und nicht zuletzt seine ungebrochene Dialogbereitschaft gegenüber den Unterdrückern Tibets immer wieder erneut an der Wirklichkeit misst.
Autor/in: Kirsten Liese, Publizistin mit Schwerpunkt Film und Musik, 23.04.2008
Mehr zum Thema auf kinofenster.de:
Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.