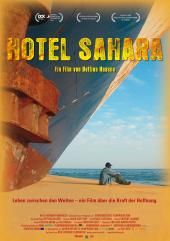Hotel Sahara
Die mauretanische Stadt Nouadhibou ist Zwischenstation für zahlreiche Flüchtlinge aus dem Süden Afrikas auf ihrem Weg nach Europa. Von dort aus stechen kleine Fischerboote zu den Kanarischen Inseln in See. Weil viele die Kosten für die illegale und lebensgefährliche Überfahrt in den "Pirogen" nicht aufbringen können, von der Polizei zurückgeholt oder von Schleppern betrogen werden, müssen sie auf unbestimmte Zeit in Nouadhibou bleiben. Die drei zentralen Protagonisten/innen des Films erzählen ihre persönliche Geschichte: Der Kameruner Valtis, 22 Jahre alt, arbeitet als Taxifahrer, um Geld zu sparen, der 20-jährige Lamiya aus Guinea möchte in Europa Profifußballer werden, die Familie von Chichi hat die horrende Summe von über 10.000 Euro aufgebracht, damit die 23-jährige Nigerianerin auswandern kann.
In ihrem Film betrachtet Regisseurin Bettina Haasen das Thema Migration aus der Perspektive der unmittelbar Betroffenen. Mit Nahaufnahmen von den Gesichtern der Protagonisten/innen bleibt sie dicht an deren persönlichen Schicksalen. Lange Kameraeinstellungen entsprechen der Situation des unabsehbaren Wartens und der Stagnation. Ein Gefühl der Entwurzelung und Entfremdung vermitteln durch gleißendes Licht verfremdete Bilder sowie Detailaufnahmen der heruntergekommenen Umgebung. Die ästhetisch durchkomponierten, atmosphärischen Bilder setzen sich vom Stil einer Reportage deutlich ab. Zudem verzichtet Haasen gänzlich auf einen Off-Kommentar, Aussagen der Protagonisten/innen wechseln sich mit einer Mischung aus Atmos (Hintergrundgeräuschen) und unaufdringlicher Filmmusik ab.
In seiner Mischung aus Authentizität und Kunsthaftigkeit erscheint Hotel Sahara als Parabel auf die oftmals irreversible Lage von Flüchtlingen, die in Auffang- und Abschiebelagern weit entfernt sowohl von der Heimat als auch dem Sehnsuchtsziel Europa zwischen Elend und Hoffnung festsitzen. Dabei vermitteln die Erzählungen der Migranten/innen ein komplexes Bild ihrer unterschiedlichen Motivationen, Biografien und Zukunftsvisionen. Diese differenzierte und klischeefreie Darstellung offeriert fruchtbare Möglichkeiten, mit Jugendlichen die tieferen Beweggründe von Migration zu erforschen. Die ungewöhnliche formale Umsetzung kann zudem dazu genutzt werden, die stilistischen Mittel zu analysieren, die dem Film seinen universellen Charakter verleihen.
In ihrem Film betrachtet Regisseurin Bettina Haasen das Thema Migration aus der Perspektive der unmittelbar Betroffenen. Mit Nahaufnahmen von den Gesichtern der Protagonisten/innen bleibt sie dicht an deren persönlichen Schicksalen. Lange Kameraeinstellungen entsprechen der Situation des unabsehbaren Wartens und der Stagnation. Ein Gefühl der Entwurzelung und Entfremdung vermitteln durch gleißendes Licht verfremdete Bilder sowie Detailaufnahmen der heruntergekommenen Umgebung. Die ästhetisch durchkomponierten, atmosphärischen Bilder setzen sich vom Stil einer Reportage deutlich ab. Zudem verzichtet Haasen gänzlich auf einen Off-Kommentar, Aussagen der Protagonisten/innen wechseln sich mit einer Mischung aus Atmos (Hintergrundgeräuschen) und unaufdringlicher Filmmusik ab.
In seiner Mischung aus Authentizität und Kunsthaftigkeit erscheint Hotel Sahara als Parabel auf die oftmals irreversible Lage von Flüchtlingen, die in Auffang- und Abschiebelagern weit entfernt sowohl von der Heimat als auch dem Sehnsuchtsziel Europa zwischen Elend und Hoffnung festsitzen. Dabei vermitteln die Erzählungen der Migranten/innen ein komplexes Bild ihrer unterschiedlichen Motivationen, Biografien und Zukunftsvisionen. Diese differenzierte und klischeefreie Darstellung offeriert fruchtbare Möglichkeiten, mit Jugendlichen die tieferen Beweggründe von Migration zu erforschen. Die ungewöhnliche formale Umsetzung kann zudem dazu genutzt werden, die stilistischen Mittel zu analysieren, die dem Film seinen universellen Charakter verleihen.
Autor/in: Stefanie Zobl, 03.08.2009
Mehr zum Thema auf kinofenster.de:
Als der Wind den Sand berührte (Filmbesprechung vom 25.07.2007)
Exil (Filmbesprechung vom 23.10.2006)
Touki Bouki (Filmbesprechung vom 19.10.2006)
Weitere Texte finden Sie mit unserer Suchfunktion.Exil (Filmbesprechung vom 23.10.2006)
Touki Bouki (Filmbesprechung vom 19.10.2006)
Weiterführende Links
Pädagogisches Material zum Film
Methoden der Filmarbeit
Über kinofenster.de