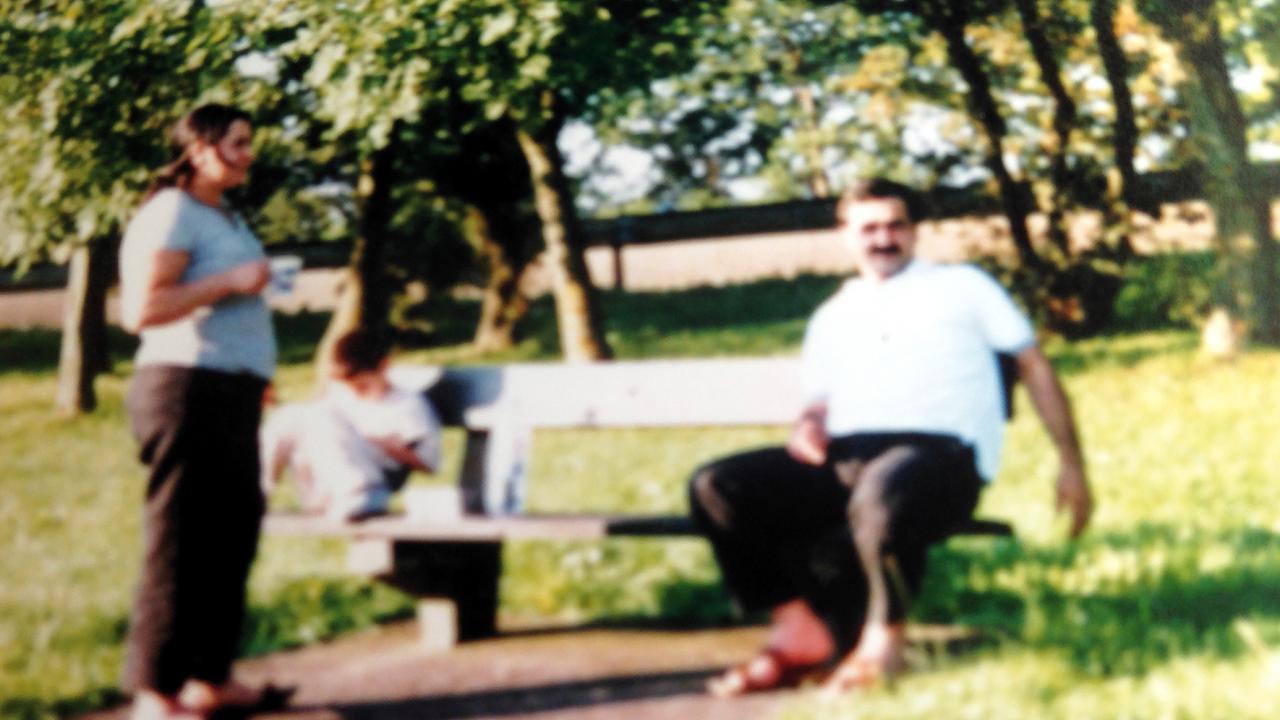Kategorie: Hintergrund
Zwischen Aufarbeitung und Traumabewältigung
Erinnern und Gedenken im Dokumentarfilm "Die Möllner Briefe"
Martina Priessners Dokumentarfilm führt verschiedene Formen des Gedenkens und Erinnerns an die rechtsextremistischen Mordanschläge vor Augen.

Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den rechtsextremen Anschlägen der frühen 1990er-Jahre in Deutschland fand in der Öffentlichkeit erst mit großer Verzögerung statt. Vor allem die Perspektive der Opfer spielte lange Zeit keine zentrale Rolle bei der Erinnerung an die rassistischen Angriffe auf die Unterkünfte von Asylbewerber/-innen und vietnamesischen Vertragsarbeiter/-innen in Hoyerswerda (September 1991) und Rostock-Lichtenhagen (August 1992) sowie die Brandanschläge auf Wohnhäuser der türkeistämmigen Familien in Mölln (November 1992) und Solingen (Mai 1993). Auch im deutschen Kino interessierte sich kaum jemand für die Wahrnehmung der Betroffenen. Zwar entstanden nach den Anschlägen einige Zum Inhalt: dokumentarische Filme, diese kreisten jedoch häufig um die Frage der politischen Verantwortlichkeit und um die rassistischen Motive der Täter. Auch in fiktionalen Filmen (Glossar: Zum Inhalt: Spielfilm) wie Zum Filmarchiv: "Wir sind jung. Wir sind stark." (Burhan Qurbani, DE 2014) stand primär die Täterperspektive im Mittelpunkt. Dass Filme sich bewusst mit der Wahrnehmung der Opfer befassten und diese selbst zu Wort kommen ließen, wie etwa in der beeindruckenden britischen Dokumentation "The Truth Lies in Rostock" (Mark Saunders und Siobhan Cleary, GB 1993), blieb eine Ausnahme.
Erst mit großer Verzögerung rückten die Erinnerungen der Betroffenen stärker in den Fokus, beispielsweise in "Hoyerswerda '91 - Eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung" (Nils Werner, Christian Hans Schulz, DE 2021), einer vom MDR produzierten Dokumentation zum 30. Jahrestag des Pogroms. Auch bei anderen Filmen über rechtsextremistische Anschläge in der jüngeren Vergangenheit wurde die Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt gestellt, wie in der dokumentarischen Trilogie Zum Filmarchiv: "Einzeltäter" (Julian Vogel, DE 2023) über die Anschläge von Hanau, München und Halle oder in Zum Filmarchiv: "Spuren – Die Opfer des NSU " (Aysun Bodemsoy, DE 2020). Die Filme hatten eine wichtige Funktion, weil sie die Menschen sichtbar machten, die von der rechtsextremen Gewalt betroffen waren. Mit ihrem Film "Die Möllner Briefe" knüpft Martina Priessner an diesen Perspektivwechsel an. Sie wirft einen Blick zurück auf die Mordanschläge von Mölln, bei denen drei Menschen ums Leben kamen. Indem sie den Überlebenden eine Stimme gibt und sie bei ihrer individuellen Aufarbeitung begleitet, leistet sie mit ihrem Film eine wichtige und intensive Erinnerungsarbeit. Im Detail lassen sich verschiedene Formen des Erinnerns beschreiben, in denen jeweils die Gefühle und Erfahrungen der Angehörigen im Zentrum stehen.
Persönliches und gegenständliches Erinnern
Zur Vermittlung nutzt der Film einerseits klassische Interviews, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihre Perspektive zu schildern. Im Zentrum steht dabei İbrahim Arslan, der als Kind die Brandanschläge überlebt hat und intensiv um eine Form des Erinnerns kämpft, bei der die Opfer im Mittelpunkt stehen – anders als lange Zeit bei den von der Stadt organisierten Gedenkveranstaltungen. Daneben kommen weitere Familienangehörige zu Wort, so İbrahims Geschwister und ihre Mutter, die auf unterschiedliche Weise mit den traumatischen Erlebnissen umgehen. Darüber hinaus greift der Film aber auch auf andere Formen des Erzählens zurück, um an die Ereignisse von Mölln zu erinnern, zum Beispiel durch die Einbindung von Gegenständen. Von zentraler Bedeutung sind dabei die titelgebenden Briefe, die 2019 durch einen Zufallsfund einer Studentin im Möllner Stadtarchiv wieder aufgetaucht sind. Diese werden zunächst indirekt vorgestellt, indem der Film İbrahim Arslan bei einem Schulbesuch begleitet, wo er Schülerinnen und Schülern die Überlieferungsgeschichte der Briefe schildert. Im Anschluss daran werden einzelne Briefe im Film zum ersten Mal eingeblendet.
Die Briefe sprechen für sich und benötigen keinen zusätzlichen Kommentar. Untermalt werden sie lediglich von einer ruhigen, atmosphärischen Zum Inhalt: Musik (komponiert von Derya Yıldırım), die ihre besondere Bedeutung unterstreicht, ohne aufdringlich zu wirken. An anderen Stellen wiederum werden die Briefe direkt vorgelesen – von den Personen, die sie vor mehr als 30 Jahren verfasst haben. İbrahim Arslan besucht diese Menschen und spricht mit ihnen über ihre damaligen Motive und die Bedeutung der Briefe in der Gegenwart.
Grenzen der Aufarbeitung
Die Offenheit der Betroffenen vor der Kamera und die Fokussierung auf ihre Perspektive ist eine große Stärke des Films, weil sich dem Publikum dadurch eine intensive Identifikationsmöglichkeit eröffnet. Sie begrenzt aber zugleich die Möglichkeiten der Aufarbeitung. Die Frage etwa, warum die Briefe 1992 nicht an die Familien weitergleitet wurden und stattdessen im Archiv in Vergessenheit gerieten, bleibt im Film offen. Der damalige Bürgermeister wollte sich dazu anscheinend nicht äußern. Dass es damals Versuche gab, die Hinterbliebenen zu kontaktieren und über die Briefe zu informieren, deutet der Film an, als İbrahim Arslan bei einem seiner Archivbesuche auf weitere Dokumente stößt.
Warum die Briefe die Betroffenen nicht erreichten, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Keiner der Angehörigen, die im Film zu Wort kommen, kann sich daran erinnern, von der Stadt kontaktiert worden zu sein. Im Abstand von 30 Jahren können die Erinnerungen daran zwar verblasst sein, zumal in der damaligen Notlage sicher viele essenzielle Dinge wichtiger waren, als die Briefe einzusehen. Letztlich erscheint es als Glücksfall, dass sie im Archiv eingelagert wurden und nicht verloren gegangen sind. Der Umgang der Behörden mit den Briefen bleibt dennoch fragwürdig, denn zahlreiche der Schreiben, die zwar an die Stadt versendet wurden, jedoch offenkundig für die Familien der Opfer gedacht waren, wurden eigenständig beantwortet, ohne Rücksprache mit den Hinterbliebenen.
Erinnerungsarbeit als individueller Bewältigungsprozess
Dass die Briefe jahrzehntelang im Archiv lagen, ohne die Angehörigen zu erreichen, ist ein Versäumnis, das sich schwer wiedergutmachen lässt. Der Film zeigt aber, dass die vielen solidarischen und trostspendenden Schreiben auch heute noch eine große Kraft besitzen. Als Zeichen der Hoffnung spielen sie eine wichtige Rolle für die Betroffenen, zumal viele von ihnen nach wie vor mit den Folgen der Ereignisse zu kämpfen haben.
Zu den intensivsten und eindringlichsten Zum Inhalt: Szenen des Films gehören daher die Momente, in denen die Angehörigen über ihre eigenen Erinnerungen sprechen. Die Erlebnisse haben schmerzliche Spuren hinterlassen, etwa bei Hava Arslan, İbrahims Mutter, deren Tochter Yeliz (10) in der Brandnacht ums Leben kam. Lange Zeit hat sie die wenigen privaten Gegenstände, die ihr von ihrer Tochter geblieben sind, aufbewahrt, ohne darüber zu sprechen. Im Film wagt sie den Schritt, sich von den persönlichen Sachen zu trennen und sie dem Dokumentationszentrum und Museum für Migration in Köln (DOMiD) zu übergeben.
Öffentliche Formen des Gedenkens und Erinnerns
Die Wertschätzung, die Hava Arslan und die anderen Angehörigen durch das DOMiD erfahren, ist ein wichtiger Schritt, um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Dazu gehört auch, dass die Möllner Briefe inzwischen an das DOMiD übergeben wurden und dort digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Im Anschluss an die Digitalisierung gehen die Briefe dann zurück an die Familien. Die Entscheidung haben die Angehörigen selbst getroffen, um zu einer aus ihrer Sicht angemessenen Form des Erinnerns zu gelangen, die sich an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert. Öffentliche Gedenkveranstaltungen der Stadt Mölln, bei denen die Hinterbliebenen lange Zeit nicht im Mittelpunkt standen, haben dies nicht vermocht. Erst seit 2023 gibt es dank der Initiative von İbrahim Arslan wieder vorsichtige Versuche, die Angehörigen in das Gedenken einzubinden – ein wichtiges Zeichen, mit dem der Film endet. Er organisiert außerdem seit vielen Jahren die sogenannte "Möllner Rede im Exil", die den Opfern von rassistischer und rechtsextremer Gewalt eine Stimme geben soll, auch über die Grenzen von Mölln hinaus. In Zeiten, in denen rassistische und fremdenfeindliche Anschläge wieder massiv zugenommen haben und rechtspopulistische Positionen in den Parlamenten wieder offen vertreten werden, erscheint die Stärkung der pluralistischen Gesellschaft wichtiger denn je. Die Erinnerung an die Ereignisse von Mölln und die Solidarität und Anteilnahme, die sich in den "Möllner Briefen" ausdrückt, ist daher auch ein Appell an die Gegenwart, rechtsextreme Gewalt nicht unwidersprochen hinzunehmen.